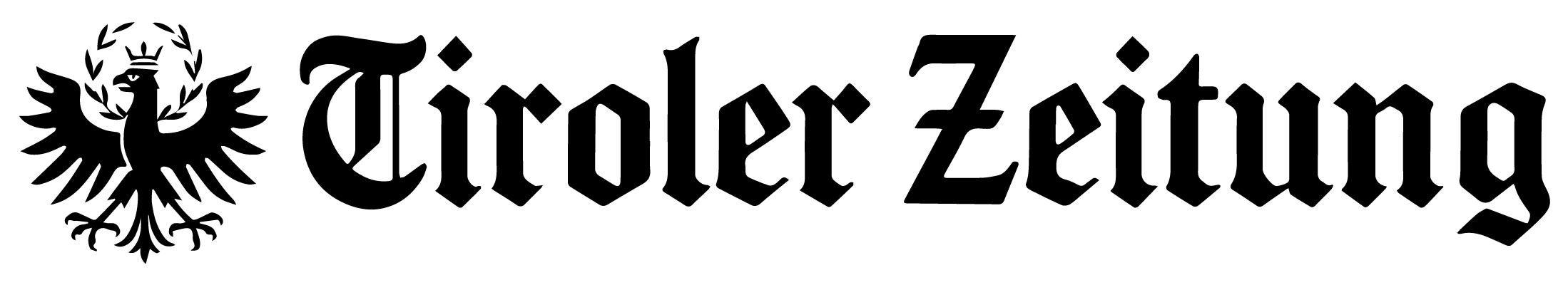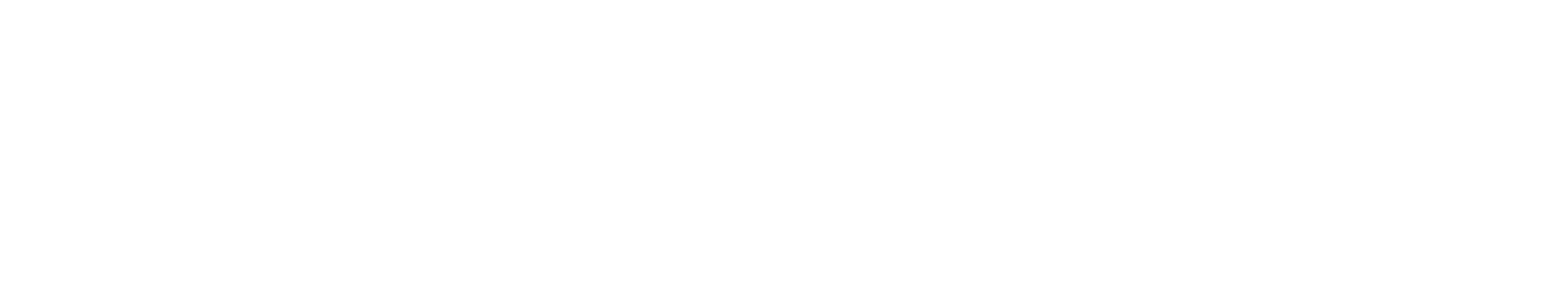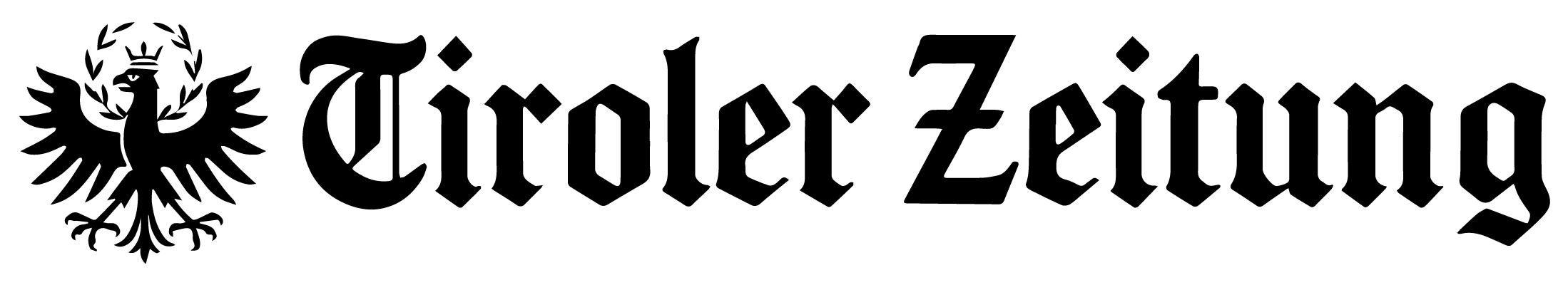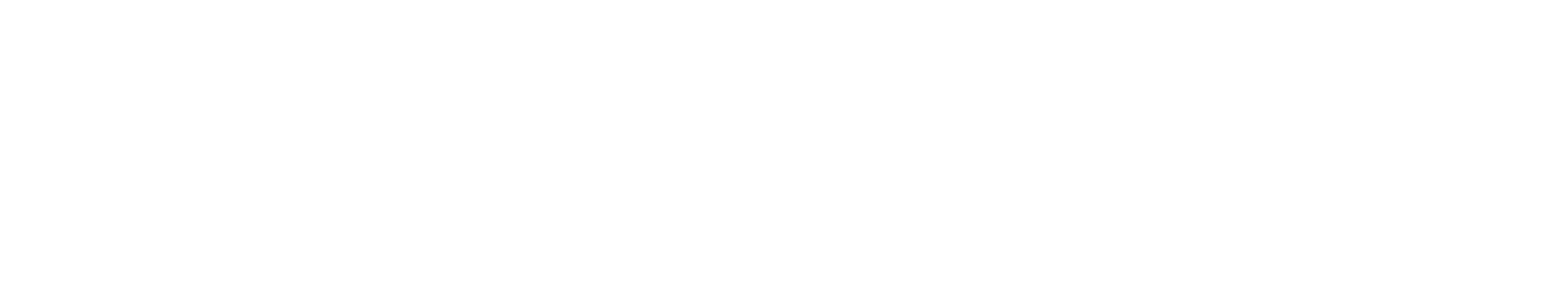Das Kabinett von Bundeskanzler Friedrich Merz hat erste Schritte zur Verschärfung der Migrationspolitik beschlossen. Die Bundesregierung plant, den Familiennachzug für bestimmte Geflüchtete auszusetzen und die Einbürgerung für besonders gut integrierte Einwanderer wieder zu verlangsamen. Die Vorschläge stammen von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und müssen noch vom Bundestag bestätigt werden.
Der Familiennachzug soll für Menschen mit subsidiärem Schutzstatus für zwei Jahre ausgesetzt werden. Diese Gruppe umfasst Geflüchtete, die zwar keinen Asylstatus erhalten, aber aufgrund von Gefahr wie politischer Verfolgung oder Folter in ihrem Herkunftsland in Deutschland bleiben dürfen. Ende März lebten laut Bundesregierung rund 388.000 Menschen mit diesem Schutzstatus hier, etwa drei Viertel davon stammen aus Syrien.
Bislang durften Angehörige von subsidiär Schutzberechtigten mit einem monatlichen Kontingent von 1.000 Personen nach Deutschland einreisen. Insgesamt wären das jährlich etwa 12.000 Personen. Zum Vergleich: Im letzten Jahr stellten knapp 230.000 Menschen in Deutschland einen ersten Asylantrag. Zwischen 2018 und 2024 entfielen rund acht Prozent aller Visa zur Familienzusammenführung auf diese Gruppe.
Ausgenommen von der Aussetzung sind sogenannte Härtefälle. Welche konkreten Situationen darunter fallen, ist im Gesetzentwurf bisher nicht klar definiert. Ähnliche Regelungen gab es bereits von 2016 bis 2018, damals mit der Begründung, die Aufnahme- und Integrationskapazitäten nicht zu überlasten.
Kritiker der Pläne reagieren scharf. Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl bezeichnete die geplanten Änderungen als „Katastrophe für die betroffenen Familien“. Die Sprecherin Tareq Alaows warnte, dass sichere und legale Fluchtwege geschlossen würden. Viele Familien warteten schon seit Jahren auf die Bearbeitung ihrer Anträge, sodass eine Trennung oft länger als zwei Jahre dauere.
Auch der Migrations- und Arbeitsmarktexperte Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) äußerte Bedenken. Er erklärte, dass die Trennung von Ehepartnern und Kindern für Geflüchtete eine starke psychische Belastung darstelle und die Integration erschwere.
Bei der Einbürgerung sollen die im Rahmen der Ampel-Koalition beschlossene beschleunigte Einbürgerung nach drei Jahren für besonders gut integrierte Zuwanderer wieder zurückgenommen werden. Die üblichen Einbürgerungsfristen bleiben jedoch verkürzt: Von acht auf fünf Jahre. Auch die Erlaubnis für den Doppelpass bleibt bestehen.
Brücker sieht die Rücknahme der beschleunigten Einbürgerung kritisch. Sie betreffe vor allem hochqualifizierte Einwanderer mit guten Einkommen. „Damit trifft die Änderung die Menschen, die wir in Deutschland brauchen“, so Brücker. Die Staatsbürgerschaft fördere nachweislich die Chancen auf dem Arbeitsmarkt und erhöhe den Anreiz für Fachkräfte, nach Deutschland zu kommen.
Die Bundesregierung sieht in den Maßnahmen einen Schritt zur Steuerung der Migration und zur Entlastung der Integrationsstrukturen. Ob und wie der Bundestag die Gesetzesänderungen annimmt, bleibt abzuwarten.