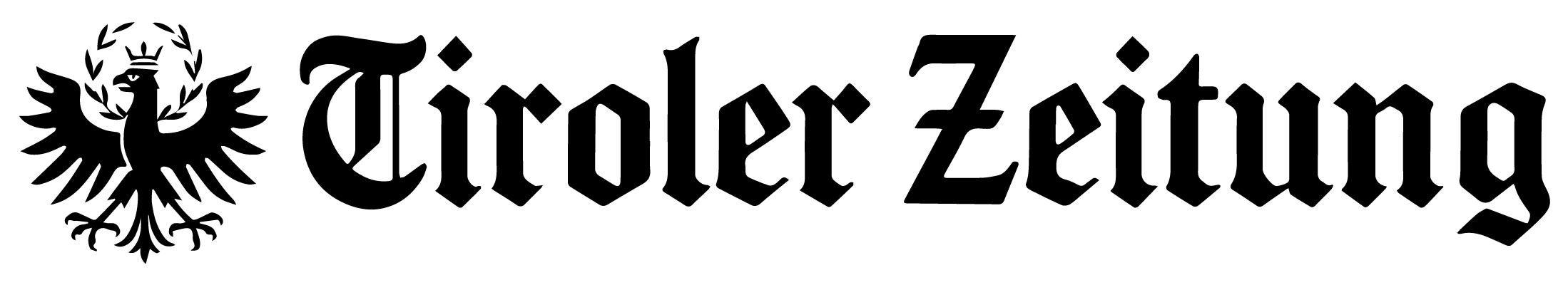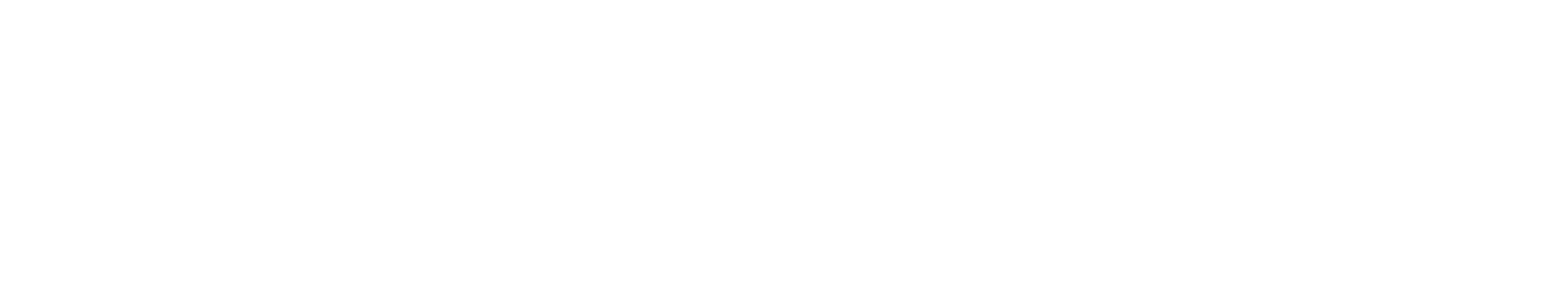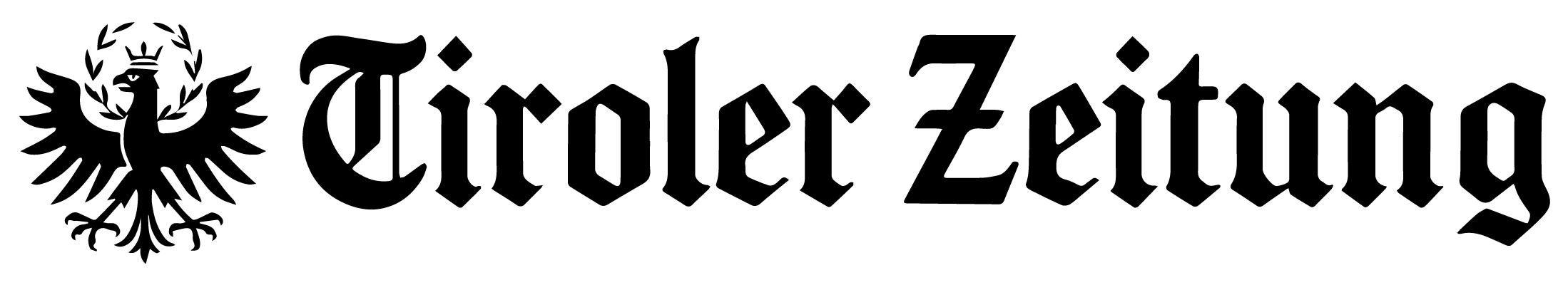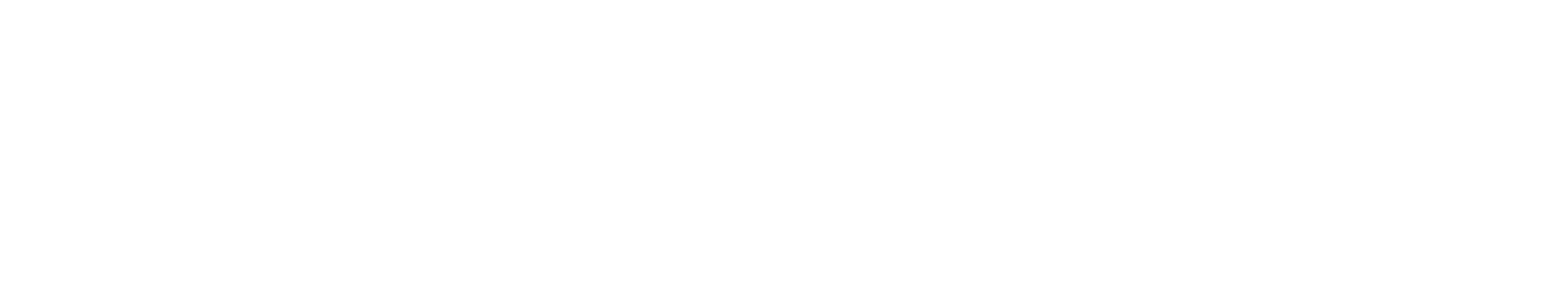Die neue schwarz-rote Regierung aus CDU, CSU und SPD will Treibhausgase unterirdisch speichern. Ziel ist es, den Ausstoß von CO2 aus Industrie und Energie zu senken. Vor allem für Fabriken und Kraftwerke mit schwer vermeidbaren Emissionen soll die sogenannte CCS-Technologie helfen. Das steht im aktuellen Koalitionsvertrag. Doch wie funktioniert das Verfahren? Wo liegen Chancen und wo mögliche Risiken?
CO2 (Kohlendioxid) ist ein Gas, das bei vielen Prozessen entsteht – etwa beim Heizen, in Fabriken oder beim Autofahren. Es trägt stark zur Erderwärmung bei. Um den Klimaschutz zu verbessern, plant die Regierung, CO2 in tiefen Gesteinsschichten zu speichern. So kann es nicht mehr in die Atmosphäre gelangen.
Bevor das CO2 gespeichert wird, muss es in Fabriken gefiltert werden. Das geschieht durch spezielle Anlagen, die das Gas von anderen Abgasen trennen. Dieser Vorgang nennt sich CCS – eine Abkürzung für “Carbon Capture and Storage”. Danach wird das CO2 über Pipelines oder Transportfahrzeuge zu Lagerstätten gebracht. Dort wird es in tiefe Gesteinsschichten gepresst, etwa in alte Gas- oder Ölfelder.
Die Regierung sieht CCS als Ergänzung zum Ausbau von Wind- und Sonnenenergie. Denn manche Fabriken können nicht komplett klimaneutral betrieben werden. Das gilt zum Beispiel für Zementwerke. Dort entsteht CO2 nicht nur durch Energie, sondern auch bei der chemischen Verarbeitung von Kalkstein. Diese Emissionen lassen sich nicht vermeiden – aber durch CCS reduzieren.
Wo soll das CO2 gespeichert werden? In Europa gelten vor allem Dänemark und Norwegen als Vorreiter. Sie nutzen alte Gasfelder im Meer als Speicher. Auch in Deutschland gibt es geeignete Orte – sowohl an Land als auch unter der Nordsee. In Brandenburg wurde das Verfahren bereits getestet. Damals gab es Proteste von Bürgerinitiativen. Viele Menschen fürchten, dass gelagertes CO2 entweichen oder das Grundwasser verschmutzen könnte.
Ein vollständiger Ersatz für andere Klimaschutzmaßnahmen ist CCS nicht. Experten sagen, dass die Technik nur einen kleinen Teil der Emissionen auffangen kann. Laut Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) liegt die mögliche Speichermenge in Deutschland bei rund 6 bis 13 Milliarden Tonnen CO2. Zum Vergleich: Deutschland stößt derzeit rund 650 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr aus. Das zeigt, dass Speicher allein nicht reichen.
Auch rechtlich ist die Lage noch unklar. In Deutschland ist es aktuell kaum möglich, CO2 einzulagern. Deshalb kooperieren Firmen wie Wintershall mit Ländern wie Dänemark. Dort gibt es schon Genehmigungen für Speicherprojekte. Die neue Koalition will nun das deutsche Recht anpassen. Noch vor der Sommerpause soll ein Gesetzesentwurf kommen. Er soll festlegen, wie Transport und Lagerung erlaubt werden können. Auch ein Netzwerk aus Pipelines ist geplant. Möglich wäre ein Anschluss an Wilhelmshaven, von wo das CO2 ins Ausland weitergeleitet wird.
Die Meinung der Bevölkerung zur CCS-Technik ist gemischt. Laut einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) sehen 40 Prozent der Menschen die Technologie positiv. Nur etwa 20 Prozent sind klar dagegen. Viele wissen aber noch zu wenig über das Verfahren, um sich eine Meinung zu bilden. Und: Viele Menschen möchten kein Lager in der Nähe ihres Wohnorts. Das IW empfiehlt daher mehr Aufklärung über Chancen und Risiken von CCS.
Der Aufbau von CCS in Deutschland steht also noch am Anfang. Klar ist: Die Technik kann helfen, besonders schädliche Emissionen zu senken. Sie ersetzt aber nicht den Umstieg auf saubere Energiequellen wie Wind, Sonne oder Strom aus Atomkraft. Nur wenn alle Maßnahmen zusammenwirken, lassen sich die Klimaziele erreichen.