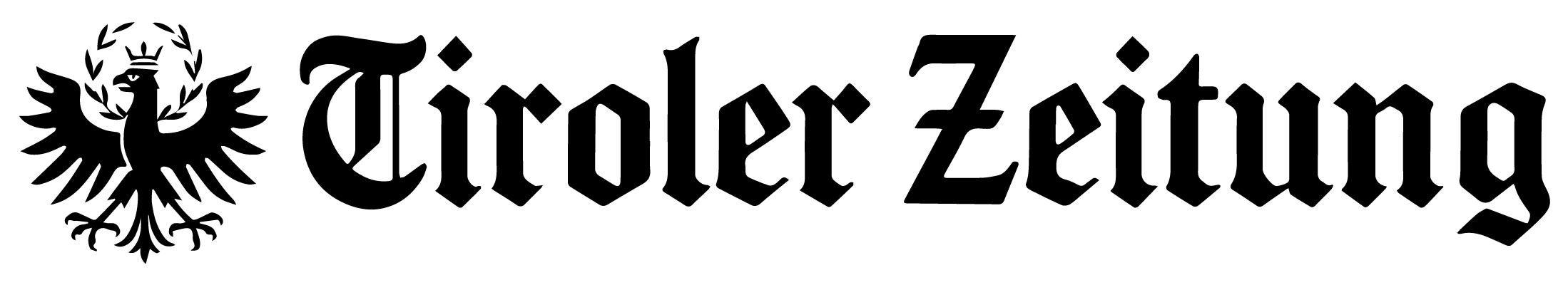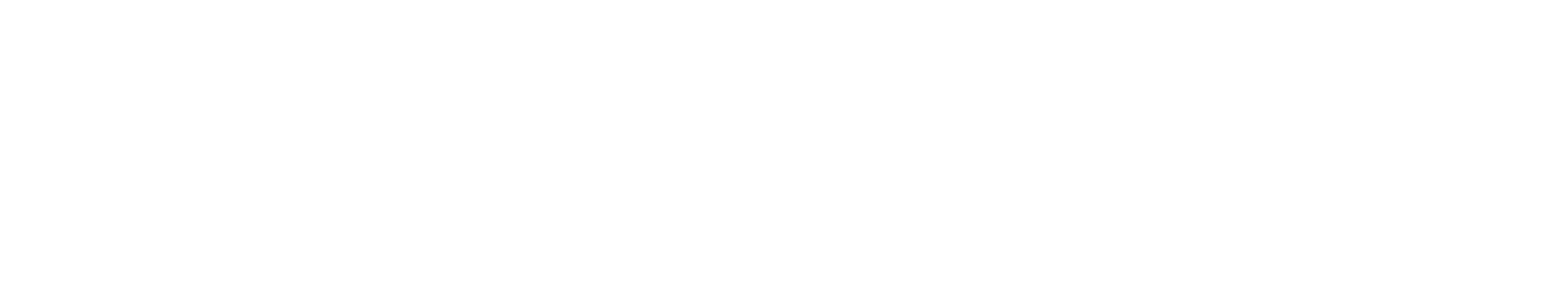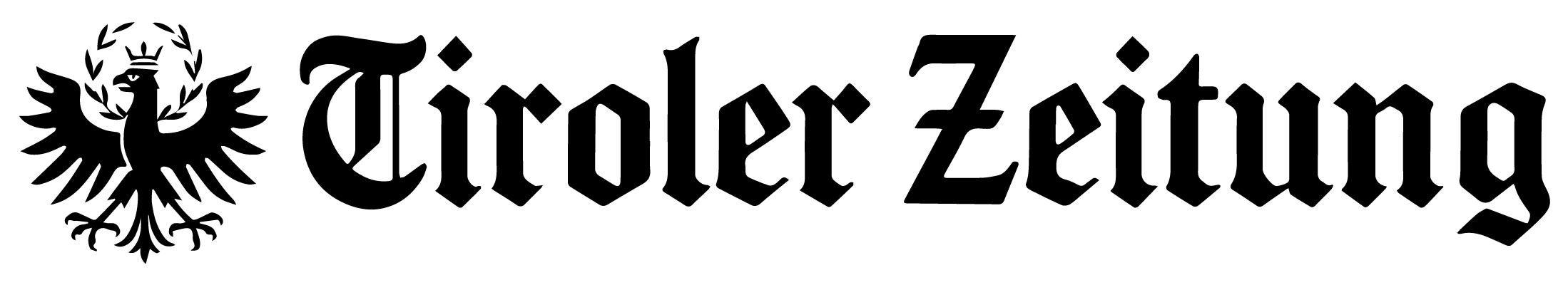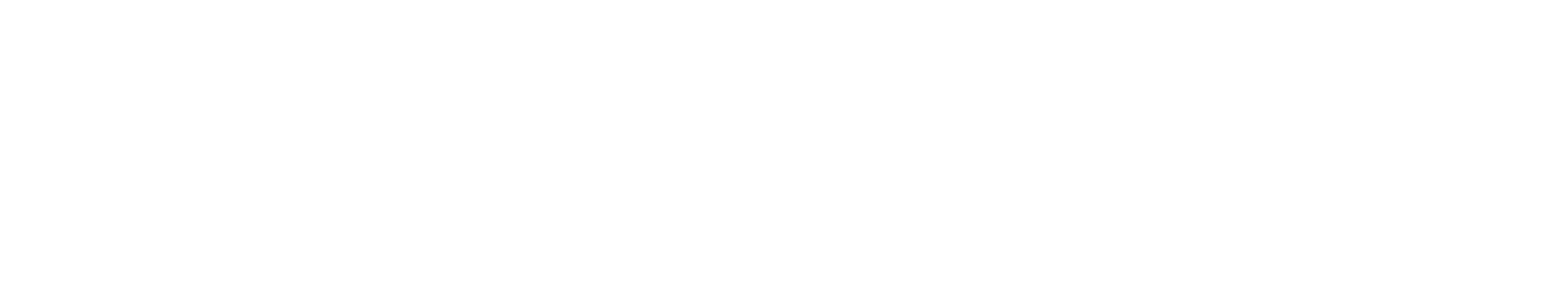Russland hatte den Minderheiten auf der Krim zugesichert, ihre Rechte zu schützen. Doch für die Krimtataren steht derzeit alles auf dem Spiel. Elf Jahre nach der Annexion der Halbinsel durch russische Truppen sind die Rechte der Tataren weitgehend ausgehöhlt. Die wichtigsten Vertretungen der Minderheit wurden verboten, die Kultur unterdrückt. Aktivisten wie Alim Aliev sprechen von einem „hybriden Genozid“ und warnen vor einer dramatischen Identitätskrise.
Krimtataren zwischen Unterdrückung und Angst
Alim Aliev ist Ukrainer, lebt in Kiew und engagiert sich als Journalist und Mitgründer der NGO „CrimeaSOS“ für die Rechte der Krimtataren. Er beschreibt die Krim als „Insel der Angst“. Die russische Annexion im Frühjahr 2014 war der Beginn einer massiven Repressionswelle. „Russlands Versprechen, die Minderheitenrechte zu achten, sind nichts wert“, sagt Aliev.
Die krimtatarischen Selbstverwaltungsorgane, Mejlis und Qurultai, wurden von Moskau als „terroristische Organisationen“ eingestuft und verboten. Laut Aliev sind derzeit von 218 politischen Gefangenen auf der Krim 132 Krimtataren – das sind mehr als die Hälfte. Die krimtatarische Bevölkerung beträgt heute nur noch rund 15 Prozent, vor der russischen Annexion waren es deutlich mehr.
Geschichte der Unterdrückung und die Folgen der Annexion
Die Unterdrückung der Krimtataren reicht weit zurück. Im 18. Jahrhundert begann die Russifizierung der ethnischen Gruppe. Unter Stalin wurden sie 1944 in Massen nach Zentralasien deportiert. Erst mit der ukrainischen Unabhängigkeit 1991 konnten viele zurückkehren. Der Gedenktag am 18. Mai für die Opfer dieser Deportation wurde kürzlich verboten.
Seit der Annexion ist die Kultur der Krimtataren massiv bedroht. Die UNESCO stuft die krimtatarische Sprache als vom Aussterben bedroht ein. Schulen wurden geschlossen, Kulturveranstaltungen finden meist heimlich statt. „Wir haben heute Lerngruppen, um unsere Sprache zu bewahren“, erklärt Aliev.
Russlands „Rekolonialisierung“ auf der Krim
Neben Repressionen nimmt die russische Regierung gezielt Einfluss auf Bildung und Gesellschaft. Russische Sicherheitskräfte, Beamte und Siedler strömten seit 2014 auf die Halbinsel – rund 800.000 Menschen. Aliev spricht von einer „Rekolonialisierung“.
In den Schulen wird unter anderem die „Junarmija“, die Jugendorganisation der russischen Armee, gefördert. Dort wird der Krieg verherrlicht, Stalin-Kult betrieben. Für viele Krimtataren entsteht so ein Konflikt: In der Schule lernen sie, russische Soldaten seien Helden, zu Hause dagegen wird ihre eigene Herkunft geleugnet oder verheimlicht.
Leben im Exil und unsichere Zukunft
Die politische Vertretung der Krimtataren arbeitet heute vor allem aus Kiew und Europa. Die Einreise auf die Krim ist für viele faktisch ausgeschlossen. Die tägliche Beschießung der Halbinsel durch ukrainische Streitkräfte und die verstärkte russische Luftabwehr machen das Leben vor Ort gefährlich.
Aliev warnt: „Es gibt Tataren auf der Krim – und Tataren außerhalb. Trotz Zensur und Überwachung versuchen beide Gruppen, den Kontakt zu halten.“ Er beschreibt die Lage als „hybriden Genozid“ und eine Stagnation seit elf Jahren. „Die Menschen fragen mich oft: Wann kommen wir zurück?“
Für Aliev und viele Krimtataren ist klar: Unter russischer Herrschaft gibt es keine Zukunft. „Russland kämpft nur für die Vergangenheit, nicht für die Zukunft“, sagt er. Die internationale Gemeinschaft hatte die Annexion 2014 weitgehend hingenommen, eine Entscheidung, die den Boden für die heutige Lage bereitet habe.
Der Kampf der Krimtataren um ihre Identität und Rechte geht weiter – trotz aller Repressionen und der schwierigen Umstände.